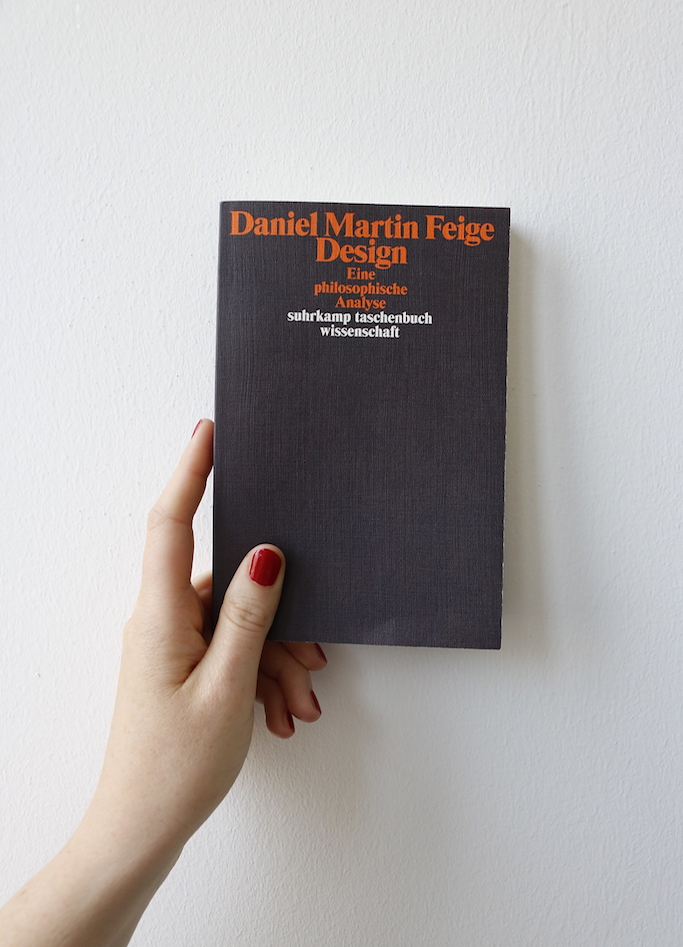„Design ist niemals unschuldig“
Gutes Design ermöglicht gutes Leben: Daniel Martin Feige entwirft in seinem Werk „Design. Eine philosophische Analyse.“ eine Philosophie des Designs und erklärt, wie es die Welt begreifbar und gestaltbar macht.
Design ist niemals unschuldig
Was haben Kriegsschiffe und Kühltürme von Atomkraftwerken gemeinsam? Etwas Bedrohliches würde man im ersten Moment meinen. Das Werkbuch-Jahrbuch (1914) und die Zeitschrift Werk (1976) sahen in ihnen Gegenstände der Gestaltung bzw. eine reizvolle Aufgabe für Architekten.
Für Feige aber ist eines klar: Design ist niemals unschuldig. Mit diesem Ansatz greift der Professor für Philosophie und Ästhetik an der Staatlichen Akademie der Bildende Künste Stuttgart Gedanken von Bruno Latour und Lucius Burckhardt auf. Burckhardt wirft dem herkömmlichen Verständnis von Design ein fälschliches Verständnis von Neutralität vor, denn „ob Designer*innen wollen oder nicht: Auch dann, wenn sie ganz profane Alltagsgegenstände entwerfen, gestalten sie damit immer schon mehr (…), sie arbeiten nämlich implizit auch an den kulturellen Praktiken mit.“ (S. 203; zitiert nach Lucius Burckhardt).
Design könne niemals neutral auf ein bloß gegebenes Problem antworten, sondern müsse im Geiste der Gedanken von Latour stets im Zusammenhang mit einem System gedacht werden, um Probleme zu erfassen und verbessern zu können. Designgegenstände sollten letztlich nie für sich allein betrachtet werden, sondern stets mit Blick auf seine Zwecke in der Umwelt.
Dass Form und Funktion bei Design, im Gegensatz zur Kunst, nicht getrennt werden können und stets im Zusammenhang mit einem System gedacht werden muss, macht die Rezensentin Maja Beckers als eine seiner Hauptthesen aus: „Design ist nicht Kunst. Während Kunst frei von praktischen Zwecken ist, dienen Designgegenstände immer einem Zweck. Und während wir uns in der Kunst selbst begegnen, so Feige, begegnen wir im Design der Welt.“
Design wird bei Feige letztlich zu einer „ästhetischen Form der praktischen Welterschließung“, die niemals unabhängig von ihren Zwecken und den sozialen Dimensionen des Kontextes beurteilt werden könne. Anders als die Kunst müsse Design für diejenigen die mit Designgegenständen umgehen, als kritische, als ermächtigende Praxis verstanden werden.
Social Design: Sozialrevolutionäres Programm oder sophistische Rhetorik?
In der „Coda: Social Design“ geht Feige der Fragestellung nach, inwieweit eine solche ermächtigende Praxis nicht bereits mit dem erreicht ist, was heute anhand des Schlagworts des Social Designs diskutiert wird.
Social Design habe von den sozialrevolutionären Programmen von Bauhaus bis Ulm gelernt und sich zugleich gegen deren entmündigenden Kern gestellt: Anstatt die bessere Gesellschaft vom Reißbrett aus zu entwerfen und über die Köpfe derer hinweg zu entscheiden, für die ihre Gestaltung gedacht ist, beabsichtige Social Design ein Korrektiv mit dem Fokus auf Partizipation und Ermächtigung zu sein. Unter Einbezug der Betroffenen selbst sollen an spezifische lokale Kontexte angepasste Lösungen entwickelt und umgesetzt werden.
Social Design muss, nach Feige, also nicht allein als Kritik der gesellschaftlichen Umstände, sondern auch also Kritik an der autoritären Rolle des herkömmlichen Designs verstanden werden. Ist Social Design demnach nicht genau diese ermächtigende Praxis, die Feige in seiner Kritik am Design fordert?
Feige sieht auch das kritisch und stellt in Frage, ob im Social Design das paternalistische Bauhaus-Verständnis von Nutzer*innen tatsächlich überwunden wird und ob das überhaupt immer Sinn macht. Aktuelle Debatten des Populismus würden es zeigen: Nutzer*innen entscheiden sich nicht immer für das, was rational gesehen am besten für sie ist. Die Unterscheidung zwischen produktiven und gefährlichen Entscheidungen sei auf der rein prozeduralen Ebene, auf der sich das Social Design bewegt, aber nur schwer zu treffen. Es drohe die Gefahr, dass Entscheidungen nur noch prozedural zu rechtfertigen ist.
Der Gedanke kollektiver Aushandlungsprozesse zur Beantwortung konkreter Herausforderungen, überzeugt dennoch. Aber Vorsicht: Social Design könne dann ins Gegenteil umkippen, wenn es positivistisch wird und vergisst, dass es Teil einer von marktlogischen Verwertungsprinzipien bestimmten Gesellschaft ist und diese letztlich sogar stärkt
Überspitzt formuliert Feige: „So wie das Angebot des Biofleisches die Kritik an der Massentierhaltung zu zähmen erlaubte und sich damit in Wahrheit mit dem, wovon es sich abgrenzen möchte, dialektisch gemein zu machen droht, so sind ökonomische Interessen besser und leichter durchzusetzen, wenn sich die betroffenen Nutzer*innen mitgenommen fühlen.“
Dann wäre Social Design für Feige weniger ein sozialrevolutionäres Programm der pragmatischen Umsetzung konkreter Ziele, als vielmehr sophistische Rhetorik, die das Gegenteil dessen tut, womit sie sich schmückt.
So oder so kommt Feige zu dem Schluss, ersetze Social Design nicht die ethische Kritik des Designs. Dafür braucht es eine kollektive Aushandlung über Mittel wie Zwecke von Designgegenständen, über gutes Design, und damit letztlich über Entwürfe für ein gutes Leben.
Zum Werk „Design. Eine philosophische Analyse.“ von Daniel Martin Feige, erschienen am 02. Februar 2018, geht es hier.
Zur Rezension „Das ist echt keine Kunst…“ von Maya Beckers, veröffentlicht am 19. März 2018 in „Die Zeit“ geht es hier.